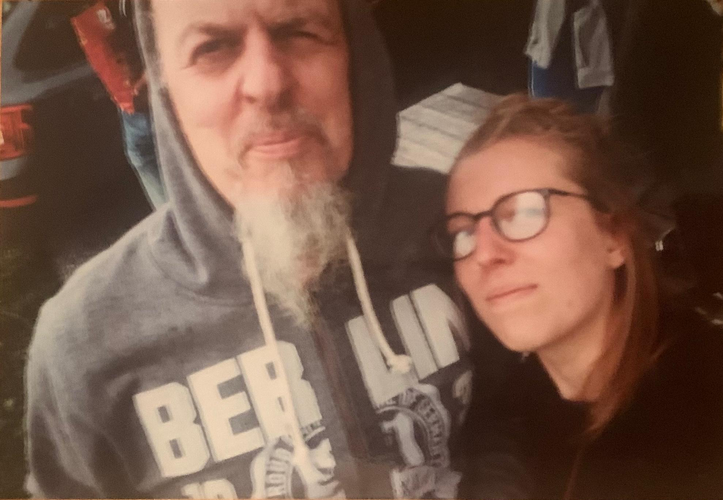Grundsätzlich unvorbereitet
Auf die Zeit nach einer erzwungenen Fürsorgemassnahme oder Fremdplatzierung waren die Betroffenen kaum vorbereitet. Unterstützung auf dem Weg in ein autonomes Leben gab es lange Zeit nur selten und findet auch heute noch ungenügend statt.
Und immer schwebt über dem Glück das Damoklesschwert
Wer von einer Fürsorgemassnahme betroffen war, konnte nur bedingt beeinflussen, wann diese ein Ende hatte.
Eine wichtige Altersgrenze war das Erreichen der Volljährigkeit, die bis 1996 bei 20 Jahren lag. Doch nicht immer war damit das Ende des behördlichen Zugriffs erreicht. Wenn ein Leben als nicht gesellschaftskonform bewertet wurde, drohten erneute Massnahmen. Gleichzeitig waren Unterstützungsleistungen, die als solche wahrgenommen wurden, rar und der Weg in ein autonomes Leben nicht selten steinig. Nicht alle schafften es, viele wählten den Freitod, weil sie mit dem Erlebten nicht zurechtkamen. ...
Unterstützung macht den Unterschied
Menschen, die anderen Menschen unter die Arme greifen, ohne danach zu fragen, woher sie kommen, können für deren weiteren Lebensweg entscheidend sein. Auch Personen, die von Fürsorgemassnahmen betroffen waren, fanden immer wieder Unterstützung und schafften es, im eigenen Leben anzukommen.

Im Winter 1963, als der Zürichsee letztmals zufror, richtete Pfarrer Ernst Sieber in einem alten Bunker eine Notschlafstelle für obdachlose Menschen ein. Fotograf: Jules Vogt
Der Zürcher Pfarrer Ernst Sieber setzte sich seit den 1960er-Jahren für Menschen ein, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden waren. Er war «Gassenarbeiter» und «Obdachlosenpfarrer». Sieber gründete unter anderem das «Christuszentrum», eine Wohngemeinschaft für gestrandete Jugendliche, darunter viele, die in Heimen aufgewachsen waren. Sie nannten ihr neues Zuhause «Schopf». Mario Delfino war der erste Bewohner.
Auch heute: Aufs Leben nicht vorbereitet
Die fehlende Unterstützung auf dem Weg in ein autonomes Leben ist auch gegenwärtig ein Thema.


Mit 18 Jahren ist man heute volljährig. Dann endet die staatliche Unterstützung für jene, die in einem Heim oder einer Pflegefamilie aufgewachsen sind. Mit den neuen Rechten kommen auch Pflichten. Es gibt Fragen rund um die Themen Auszug, Beruf oder Geld auf dem Weg in ein eigenverantwortliches Leben. Zur Unterstützung junger Erwachsener organisieren sich Menschen, die selbst nicht bei ihren Herkunftsfamilien aufgewachsen sind («Care Leaver»).
Wir sprechen in diesem Film
Und immer schwebt über dem Glück das Damoklesschwert
Wer von einer Fürsorgemassnahme betroffen war, konnte nur bedingt beeinflussen, wann diese ein Ende hatte.
Eine wichtige Altersgrenze war das Erreichen der Volljährigkeit, die bis 1996 bei 20 Jahren lag. Doch nicht immer war damit das Ende des behördlichen Zugriffs erreicht. Wenn ein Leben als nicht gesellschaftskonform bewertet wurde, drohten erneute Massnahmen. Gleichzeitig waren Unterstützungsleistungen, die als solche wahrgenommen wurden, rar und der Weg in ein autonomes Leben nicht selten steinig. Nicht alle schafften es, viele wählten den Freitod, weil sie mit dem Erlebten nicht zurechtkamen. ...
Entlassung in die Freiheit
Auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben waren Betroffene von der Beurteilung einzelner Autoritäten abhängig: In den Einrichtungen befand der leitende Direktor, der «Heimvater» oder die Oberin weitgehend über den Zeitpunkt der Entlassung und allfällige Bedingungen. Zusammen mit psychiatrischen Gutachten bildeten ihre Einschätzungen die Grundlage für die Entscheidung der einweisenden Behörden und Vormunde.
Ausschlaggebend für die Beurteilung war dabei die «Besserung» oder «Bewährung» einer Person seit ihrem Eintritt – also die Tatsache, ob sich jemand dem geltenden Anstaltsregime unterworfen hatte. Die Anstalts- und Heimleitungen verfügten so über eine grosse Machtfülle. Auch einige private Organisationen sicherten sich dieses Bestimmungsrecht über Kinder und Jugendliche in Fremdpflege, indem sie Eltern zur Unterzeichnung von Abtretungserklärungen veranlassten und dafür die Kosten der Unterbringung übernahmen.
Im Zusammenspiel mit unklar definierten Entlassungskriterien kam es zu willkürlichen Entscheidungen. Erst in der Nachkriegszeit wurde die Macht der Heimleitungen teilweise gebrochen und Expertenkommissionen zur Beurteilung der Internierten eingesetzt.
Eine Entlassung bedeutete häufig nicht absolute Freiheit. Viele Menschen standen danach unter einer sogenannten Schutzaufsicht: Sie wurden begleitet und beobachtet. Diese Funktion übernahm in vielen Kantonen ein Beamter. Die Schutzaufsicht fand somit im Spannungsfeld zwischen nachgelagerter Unterstützung und dem Zwang zu einer gesellschaftlich konformen Lebensweise statt. Im Fall einer negativen Beurteilung drohte die erneute Einweisung.
Auf der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft
Für viele Betroffene kam der Tag der Entlassung unerwartet. Plötzlich waren sie auf sich alleine gestellt und mussten selber Entscheidungen treffen, nachdem sie zuvor über Jahre fremdbestimmt gewesen waren. Auf die alltäglichen Herausforderungen des Lebens waren sie während der Fremdplatzierung kaum vorbereitet worden. Viele Betroffene besassen am Tag ihrer Entlassung nichts: keinen Kontakt zur Herkunftsfamilie, kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde, keine Arbeit, keine Perspektiven. Dieser Umstand ist bis heute aktuell, wie die aktuelle Diskussionen um die sogenannten «Care Leaver» zeigt, die ihre Kindheit in einem Heim oder in einer Pflegefamilie verbrachten.
Die Suche nach einem Platz in der Gesellschaft war für viele schwierig und dauerte oft Jahre. Das Gefühl, nicht willkommen zu sein und nicht in die Gesellschaft zu gehören, war ausgeprägt. Betroffene hatten ihre sozialen Kontakte oft verloren, und neue Beziehungen aufzubauen, war nicht einfach. Die Angst, aufgrund ihrer Vergangenheit stigmatisiert und zurückgewiesen zu werden, veranlasste viele, über das Erlebte zu schweigen. Nicht wenige flüchteten sich in Drogen und Alkohol, schlugen sich auf der Strasse durch und gerieten erneut in den Fokus der Behörden. Andere begingen Suizid.
Ein soziales Netzwerk nach der Entlassung war wichtig. Manche konnten dabei auf die Unterstützung der Eltern oder Verwandten zählen. Diese nahmen sie nach der Entlassung bei sich auf und vermittelten ihnen erste Arbeitsstellen. Andere machten glückliche Bekanntschaften im Privaten oder trafen beispielsweise auf eine Sozialarbeiterin oder einen Vorgesetzten, die sie bei der weiteren Gestaltung ihres Lebensweges unterstützten. Auf diese Weise gelang es vielen, allmählich im Leben Fuss zu fassen. Von zentraler Bedeutung in diesem oft jahrelangen Prozess war, dass die Betroffenen als Menschen mit eigenen Fähigkeiten anerkannt wurden und eine Chance erhielten.